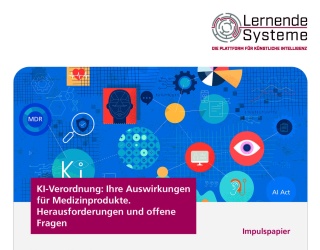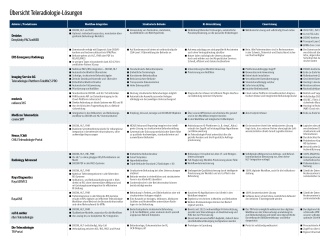AI Innovation Platform
Franziska Lobig und Guido Mathews erklären im Gespräch mit Guido Gebhardt, wie Bayer mit der KI-Innovationsplattform, aber auch Angeboten wie dem CoLab die Entwicklung von KI-Lösungen für die Radiologie voranbringen wollen.
Was genau ist die AI Innovation Platform von Bayer?
Franziska Lobig: Stellen Sie sich eine umfassende, sichere und datenschutzkonforme Umgebung für die Entwicklung medizinischer KI vor, die alle Phasen des Prozesses, benötigte Entwicklungswerkzeuge und domänenspezifische Expertise miteinander verbindet. Es handelt sich also um eine isolierte und skalierbare Plattform, die von der Datenbeschaffung über die erste Codezeile bis hin zur regulatorischen Validierung und der fertigen KI-Anwendung reicht. Entwickler können Modelle trainieren, versionieren, testen und validieren, ohne das System zwischendurch wechseln zu müssen. Unser Ziel ist es, Daten so aufzubereiten, dass sie für KI-Anwendungen nutzbar sind und gleichzeitig alle Anforderungen an Datenschutz und Patientensicherheit erfüllt werden.
Guido Mathews: Kurz gesagt: Wir beseitigen Reibungsverluste im Entwicklungsprozess und bieten eine vollständige Umgebung, die Entwicklungs- und Validierungszeiten erheblich verkürzt.
Wo bremsen klassische Prozesse die KI-Entwicklung heute am stärksten – und wie setzt Ihre Plattform dort an?
Guido Mathews: Ein wesentlicher Engpass ist der Zugang zu Daten. Wer 5.000 kuratierte Datensätze braucht, muss oft monatelang mit Anbietern verhandeln, inkompatible Angebote vergleichen und sich anschließend mit Transfer- und Daten-Compliance-Hürden auseinandersetzen. Unsere Plattform bietet daher einen integrierten Daten-Marktplatz: Entwickler können in wenigen Minuten herausfinden, welcher Anbieter passende Daten hat, welche Qualität diese aufweisen und welche Kosten anfallen – Bestellung und sichere Bereitstellung inklusive. Dadurch wird ein normalerweise achtmonatiger Prozess auf wenige Klicks reduziert. Eine US-Umfrage zeigt, dass 80 % der KI-Projekte wegen solcher Herausforderungen mit Daten Verzögerungen erfahren; genau hier setzen wir an.
Welche konkreten Vorteile bietet das System insbesondere Start-ups?
Franziska Lobig: Viele Gründer starten lokal, wechseln mehrfach zwischen verschiedenen Cloud-Lösungen und verlieren dabei oft die Dokumentation. Unsere Entwicklungsumgebung kann in rund zehn Minuten ISO-konform konfiguriert werden, skaliert auf Knopfdruck und speichert automatisch alle Audit-Trails. Dadurch können Teams sofort zusammenarbeiten und verfügen bei einer späteren Zulassung bereits über eine lückenlose Prozess-Chronologie – ein erheblicher Zeitgewinn für junge Unternehmen. Technisch basiert unsere Plattform auf Google Cloud und nutzt Tools wie Vertex AI, BigQuery, Healthcare API und Chronicle.

Bayer hat kürzlich in Berlin ein Gene- & Cell-Therapy-Center angekündigt und einen Start-up-Inkubator eröffnet. Wie greift das alles ineinander?
Guido Mathews: Das Bayer Co.Lab in Berlin ist Teil des globalen Bayer-Netzwerks von Life-Science-Inkubatoren in wichtigen Innovationszentren wie Cambridge (USA), Kobe (Japan) und Shanghai (China). Und der neue, hochmoderne Inkubator in Berlin bietet Start-ups Zugang zu voll ausgestatteten Räumlichkeiten sowie maßgeschneiderte Unterstützung und Mentoring durch Bayer-Experten, um wissenschaftliche Durchbrüche in der Zell- und Gentherapie und Onkologie voranzutreiben.
Dies steht auch im Zusammenhang mit der Eröffnung des Zell- und Gen-Therapie-Centers: Unser Imaging Core Lab aus dem Bereich Radiologie, das bereits Bildanalysen für klinische Studien liefert und Start-ups im Co.Lab könnten direkt auf der KI-Innovationsplattform arbeiten. So entstünde ein durchgängiges Ökosystem von der frühen Forschung bis zum marktreifen Produkt – ein einzigartiges Angebot in der Branche.
Auf Kongressen wie dem RSNA 2024 und dem ECR 2025 dominierten Begriffe wie Foundation Models und Integrated Diagnostics. Wie positioniert sich Bayer mit seiner KI-Umgebung?
Guido Mathews: Derzeit konzentrieren wir uns auf die Pharma-Forschung, wo wir unter anderem Multiomics-Daten, Genotypisierung, Blut-Biomarker und Bildgebung miteinander verknüpfen, um fundierte Go/No-Go-Entscheidungen treffen zu können. Mittelfristig planen wir, auf unserer Plattform Pipelines zu entwickeln, über die Entwickler eigene oder vortrainierte Modelle austauschen können.
Franziska Lobig: Das Thema Foundation Model betrachten wir aus zwei Perspektiven: Zum einen integrieren wir Large-Language-Models bereits als Cloud-Service; zum anderen entwickeln wir Imaging-Modelle, etwa für Leber- oder Thorax-MRT, die als synthetische Daten-Generatoren oder für Transfer-Learning genutzt werden können. Ein bereits trainiertes Modell kann so für eine neue, aber ähnliche Anforderung angewendet werden. Architektonisch ermöglichen wir beides und möchten auf diese Weise eine offene Community fördern.
Warum startete die KI-Revolution ausgerechnet in der Radiologie – und was kommt als Nächstes?
Franziska Lobig: Die Radiologie war frühzeitig digitalisiert, wobei die Bilddaten oftmals schon in strukturierter Form vorlagen. Dort, wo Datenmengen vorhanden sind, entstehen Innovationen. Zudem sind Radiologen häufig auch sehr technikaffin. In Zukunft wird die Radiologie eine Schlüsselrolle in der integrierten Versorgung spielen: Durch die Kombination von Radiomics, Pathologie-Bildern und Gen-Sequenzen, könnten völlig neue Diagnose- und Therapieansätze entwickelt werden.

Können Sie ein Beispiel nennen, wie Bild-Biomarker die Therapie verändern könnten?
Franziska Lobig: Nehmen wir Parkinson als Beispiel. Heute beurteilen wir die Fortgeschrittenheit der Krankheit anhand subjektiver On/Off-Zeiten, wobei „On-Zeiten“ die Phasen beschreiben, in denen die Medikation wirksam ist und der Patient eine verbesserte Beweglichkeit zeigt, während „Off-Zeiten“ die Perioden darstellen, in denen die Symptome zurückkehren und die Medikation nicht ausreichend wirkt. Ein verlässlicher Biomarker, der auf Bildgebungsdaten basiert, könnte präziser den Zeitpunkt identifizieren, an dem eine Zell- oder Gentherapie am effektivsten wirkt. Wir analysieren aktuell große Kohorten von MRT-Daten, um Muster zu finden, die dem menschlichen Auge verborgen bleiben. Wenn uns das gelingt, können Therapien möglicherweise präziser geplant und neue Wirkstoffe schneller entwickelt werden.
Welche Rolle spielen Regulatorik und Politik, um Daten überhaupt nutzbar zu machen?
Guido Mathews: Ohne harmonisierte Standards bleiben viele Ideen fragmentiert. Der European Health Data Space zielt darauf ab, Patientendaten sicher und durchgängig verfügbar zu machen; während das INDEX-Programm in den USA einen landesweiten Austausch von Bildgebungsdaten fördert. Solche Initiativen sind entscheidend, damit KI nicht nur auf Daten von drei Großkliniken trainiert wird, sondern auf vielfältigen und repräsentativen Kohorten.
RadMag: Was muss passieren, damit Kliniken und Kostenträger KI flächendeckend einsetzen?
Franziska Lobig: Dazu brauchen wir zum einen ausreichend verfügbare Trainingsdaten und zum anderen Erstattungsmodelle, die patientenzentrierte Mehrwerte honorieren und nicht nur Effizienzgewinne berücksichtigen. Das bevorstehende deutsche Lungenkrebs-Screening könnte hier zum Lackmustest dienen: Etwa 20 zugelassene Algorithmen werden miteinander verglichen und die Evaluation wird zeigen, ob und welche Lösungen tatsächliche Mehrwerte bieten. Gelingen transparente Vergleiche und eine faire Vergütung, könnte eine Vorlage für viele weitere Indikationen entstehen. Für die Kliniken ist es zudem wichtig, dass sie KI-basierte Lösungen einfach und unkompliziert in ihren Klinikalltag integrieren können und diese sie effektiv bei ihren Herausforderungen unterstützen.