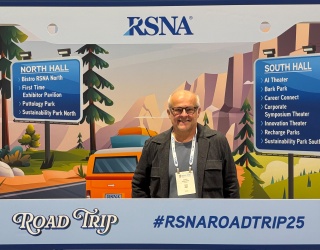Die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Physik (DGMP) 2025 zeigt, wie dynamisch sich das Fachgebiet weiterentwickelt. In Berlin-Dahlem treffen sich Ende September Expertinnen und Experten, um neueste Erkenntnisse aus Strahlentherapie, Bildgebung und Dosimetrie mit Zukunftsthemen wie Medizinischer Optik, Audiologie und Künstlicher Intelligenz zu verbinden.
Im Gespräch mit der Tagungsleitung Prof. Dr. Markus Buchgeister (Berliner Hochschule für Technik) und Prof. Dr. Andrea Denker (Helmholtz-Zentrum Berlin) geht es um die Highlights des Kongresses – von innovativen Lichtverfahren über nachhaltige Ansätze in Klinik und Forschung bis hin zur Rolle der KI in der Medizinischen Physik.
Die Jahrestagung der DGMP 2025 verspricht ein breites Spektrum an Themen. Was waren Ihrer Meinung nach die drei größten Highlights, auf die Sie sich besonders freuten oder von denen Sie sich neue Impulse erhofften?
Prof. Dr. Buchgeister: Dieses Jahr hat die DGMP-Tagung ihre besonderen Schwerpunkte erstmalig in den drei Themengebieten: Medizinische Optik, Augentumorbestrahlung und die Aus- und Weiterbildung von Medizinphysikern. Nach vielen Jahren freuen wir uns, dass wir wieder die Medizinphysikkollegen auf der Tagung dabeihaben, die Verfahren mit Licht erforschen und einsetzen. Passend dazu und natürlich, weil es auch ein besonderes Highlight von Berlin ist, die Augentumortherapie, deren Pionierarbeit zur Bestrahlung mit Protonen am Zyklotrondes Helmholtz-Zentrum Berlin erfolgte. Und last but not least gilt der Blick in unsere Zukunft, die wir ohne eine gute Ausbildung des Nachwuchses sowie der kontinuierlichen Weiterbildung und Sicherung unseres Berufsstandes ebenfalls zu einem besonderen Diskussionsthema der Tagung machen möchten.
Gibt es aus Ihrer Sicht aktuelle Trends oder Entwicklungen, die das Feld der Medizinischen Physik in den nächsten fünf bis zehn Jahren maßgeblich prägen werden?
Auch an der Medizinischen Physik geht der Einsatz der Künstlichen Intelligenz nicht vorbei. Dies machen wir insbesondere zum Thema unseres erstmaligen digitalen Vorkongresses, damit unsere Teilnehmer daran ohne Parallelsessions und niederschwellig schon vor der Anreise nach Berlin teilnehmen können, um sich dann auf dem Kongress intensiv darüber austauschen zu können. Nicht damit verbunden, aber auch den IT-Bereich betreffend, ist das Thema „Cybersecurity“, das wir zunehmend ernster in den Blick nehmen müssen, denn sowohl die Forschung als auch die klinische Routineversorgung sind ohne IT-Systeme nicht mehr denkbar. Weiter werden wir über die Zukunft neuer Bestrahlungsformen wie FLASH miteinander diskutieren, um die Strahlentherapie von Tumoren zu verbessern, indem die Dosisgrenzen für Normalgewebsreaktionen hoffentlich weiter erhöht werden können.
Der digitale Vorkongress ist eine Neuerung in diesem Jahr. Welche Vorteile sehen Sie in diesem Format?
Wie bereits erwähnt, möchten wir den Teilnehmern am Kongress bereits vor der Anreise eine niederschwellige Teilnahme an zwei Sessions zu besonderen aktuellen Themen ohne Parallelsessions bieten, über die sich die Kollegen dann im Gespräch auf dem Kongress bei verschiedenen Gelegenheiten austauschen können: „KI in den strahlenden Fächern: Überblick und aktuelle Themen“ und „Strahlennotfälle und Notfallschutz“. Das zweite Thema dient der Vorbereitung auf etwas, das wir alle nicht erleben möchten, aber für das wir mit unserem Fachwissen Wesentliches beitragen können.
Inwiefern sehen Sie KI als Game-Changer für die medizinische Strahlungsphysik, beispielsweise in der Bildgebung oder Therapieplanung?
Der Einsatz von Methoden der künstlichen Intelligenz bietet die Option zur Sammlung bzw. durch entsprechendes Training „Erfahrungswissen“ z.B. über die Verteilung von Streustrahlungen in der Bildgebung für typische Fälle schneller als durch aufwändige Monte-Carlo-Simulationsrechnungen bereitstellen zu können, sodass für den Radiologen diagnostisch verwertbare Bilder mit noch weniger Strahlendosis bereitgestellt werden können. Davon profitieren dann insbesondere Patienten, die aufgrund ihrer Erkrankung häufigere Untersuchungen mit ionisierender Strahlung benötigen.
Die Tagung deckt traditionelle Bereiche ab, integriert aber auch verstärkt Medizinische Optik. Was war der Impuls für diese stärkere Integration, und welche neuen Perspektiven ergeben sich dadurch für die Medizinische Physik?
Wir freuen uns über die Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Biophotonik und Lasermedizin e.V. im Rahmen eines besonderen Symposiums, das sowohl die präklinische Forschung als auch den klinischen Einsatz von Lasern und besonderen Mikroskopie-Techniken zum Thema hat. Die Optik ist ein weiteres gutes Beispiel für die Kooperation von Physik und Medizin als zwei Seiten einer Medaille. Diese Kooperation, die bereits im letzten Jahr mit einer Winterschulwoche in Pichl/Österreich begonnen hat, möchten wir gern in den nächsten Jahren intensivieren.
Das Thema Nachhaltigkeit wird durch "DGMP goes Green" konsequent verfolgt. Wie sehen Sie die Rolle der Medizinischen Physik bei der Entwicklung energieeffizienter Lösungen in Klinik und Praxis?
Dies ist ein exzellentes Beispiel dafür, dass Medizinphysiker auch über ihr primäres Tätigkeitsgebiet in der klinischen Versorgung der Patienten hinausschauen und aufgrund ihrer physikalisch-technischen Ausbildung auch die Optimierung des Energieeinsatzes in ihrem Horizont haben. Das mache ich mittlerweile auch schon zu einem Thema für Studierende in meinen Kursen an der Hochschule. Weiter berücksichtigen wir das Thema Nachhaltigkeit übrigens auch schon länger in der Gestaltung unseres Kongresses durch eine CO2-Kompensation der Anreise wie auch durch Vermeidung unnötiger Abfälle beim Catering.
Professor Buchgeister, Ihr Fachgebiet, die Medizinische Strahlungsphysik, ist sehr umfassend. Welche aktuellen Entwicklungen oder Forschungsergebnisse in diesem Bereich halten Sie für besonders vielversprechend und werden auf der Tagung eine wichtige Rolle spielen?
Prof. Dr. Buchgeister: Seit einigen Jahren wird die FLASH-Therapie intensiv diskutiert, jedoch ist diese noch nicht ausreichend erforscht. Auch die technische Umsetzung mit konventionellen Bestrahlungsgeräten für den Routineeinsatz ist noch nicht realisiert – anders als etwa bei der Flatening-Filter-Free-(FFF)-Bestrahlungstechnik, die mittlerweile etabliert ist. Ich bin gespannt, was ich dazu im Rahmen meines Rundgangs durch die Industrieausstellung von den Unternehmen erfahren werde.
Prof. Dr. Denker: Die sogenannte FLASH-Therapie stellt jedoch auch neue Herausforderungen für die Dosimetrie, die Strahlanlieferung und den Beschleuniger dar. Das bedeutet auch die Entwicklung neuer Beschleuniger, die die Anforderungen in puncto Intensität, Zuverlässigkeit, Reproduzierbarkeit und Stabilität erfüllen.
Frau Professorin Denker, das bunte Auge im Emblem symbolisiert die erfolgreiche Tradition der Protonentherapie von Augentumoren. Könnten Sie kurz die Einzigartigkeit dieser Behandlungsmethode am Protonenbestrahlungszentrum der Charité und des Helmholtz-Zentrums Berlin erläutern und welche Fortschritte hier erzielt wurden?
Die ausgesprochen fruchtvolle Zusammenarbeit zwischen der Charité Universitätsmedizin Berlin und dem Helmholtz-Zentrum Berlin geht nun über 25 Jahre. Wir waren die Ersten, die Protonen in Deutschland zur medizinischen Anwendung gebracht haben, und haben gemeinsam nun fast 5000 Patienten behandelt. Das Besondere an unserem Beschleuniger ist, dass er für die Augentumortherapie besonders gut geeignet ist. An der hinteren Kante des Bestrahlungsfeldes fällt die Dosis innerhalb weniger als eines Millimeters von 90 Prozent der Dosis auf 10 Prozent der Dosis ab. Das ermöglicht eine bessere Schonung von Risikostrukturen, die sich in der Nähe des Tumors befinden.
Das Interview führte Katrin Franz.